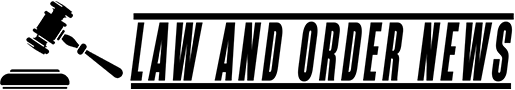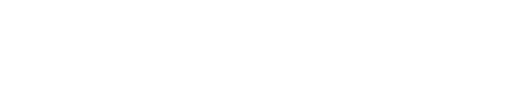Extremistische Betätigung als Ausschlussgrund für den juristischen Vorbereitungsdienst
Nachdem bereits der Fall „Rechtsreferendar III. Weg“ für Diskussionen um Zugangsvoraussetzungen zum juristischen Vorbereitungsdienst gesorgt hat (Jonas Deyda auf diesem Weblog hier und hier), tritt mit dem kürzlich ergangenen Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg eine weitere gerichtliche Entscheidung mit eigenen Argumentationsansätzen auf den Plan. Das Gericht hatte sich mit der relevanten Frage zu beschäftigen, ob einem Kandidaten die Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst verwehrt werden kann, wenn er die Verfassungsordnung aktiv bekämpft, ohne sich dabei strafbar zu machen. Der Beschluss offenbart erneut die unklare und uneinheitliche Rechtsprechungslinie.
Die Zulassungsvoraussetzungen als Verfassungsschutzinstrumente
Ein Funktionär der extremistischen Partei „Die Heimat“ (ehemals NPD) hatte erfolglos beim Brandenburgischen OLG die Zulassung zum Referendariat beantragt. Seine umfangreichen Betätigungen in der NPD waren bereits für die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsfeindlichkeit der NPD aus den Jahren 2017 und 2024 related (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 04.06.2024 – OVG 4 S 14, Rn. 19). Das VG Cottbus hatte im Eilverfahren zunächst entschieden, der nicht vorbestrafte Bewerber müsse zum Vorbereitungsdienst zugelassen werden, da er trotz seiner Aktivitäten in der Partei für den Vorbereitungsdienst nicht persönlich ungeeignet sei. Diese Entscheidung hat das OVG Berlin-Brandenburg nun im Eilrechtsschutz gekippt.
In der Entscheidung des OVG treten die Grundfragen um Bewerbungen von Personen mit extremistischem Hintergrund klar hervor. Ungewiss ist zunächst, ob die beamtenrechtlichen Vorschriften und damit auch die in Artwork. 33 Abs. 5 GG veranlagte Treuepflicht bei Rechtsreferendar*innen unmittelbare oder entsprechende Anwendung finden. Weiterhin ist umstritten, wie sich die Zulassungsvoraussetzungen nach den Juristenausbildungsgesetzen der Länder zu § 7 BRAO verhalten, der den Zugang zur Anwaltschaft regelt und insofern relativ niedrige Hürden vorsieht. Entscheidend ist schließlich die Frage, welches Maß an Verfassungstreue den Rechtsreferendar*innen abzuverlangen ist. Die divergierenden Vorschriften der Länder zur Juristenausbildung erschweren dabei den Blick auf die übergreifenden, drängenden Fragen. Die Diskussion droht auf einen Streitstand zu treffen, der noch immer von überschießenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den sogenannten Berufsverboten verunsichert ist und noch nicht zu einem ausgewogenen Mittelweg zwischen Staats- und Diskriminierungsschutz zurückgefunden hat.
Die Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst obliegt bundesweit den jeweiligen Oberlandesgerichten. Den juristischen Vorbereitungsdienst als reine Berufsausbildung ohne besondere politische Brisanz zu verharmlosen, ginge an der Wirklichkeit vorbei. Dessen besondere Bedeutung liegt in der erstmaligen Vermittlung praktischer Kenntnisse nach einem hauptsächlich theorieorientierten ersten Staatsexamen. Daneben eröffnet die zweite Prüfung Zugang zu machtvollen Positionen im Staatsdienst und führt zu einer staatlich bescheinigten „Expertenstellung“, welche für verfassungsfeindliche Bestrebungen von unschätzbarem Wert sind. Wer eine Demokratie bekämpfen oder einen Rechtsstaat aushöhlen will, kann und wird dazu gerade auch juristische Mittel einsetzen. Nicht umsonst ruft die AfD in Verdrehung von Rudi Dutschkes Maxime zum „Marsch durch die Institutionen“ auf.
Insofern ist eine Nichtzulassung verfassungsfeindlicher Personen auch als Mittel zum Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung (FDGO) und damit als Gefahrenabwehr zu sehen. Zugleich ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Vorbereitungsdienst als notwendiger Teil der juristischen Berufsausbildung durch Artwork. 12 GG geschützt. Für die betroffenen Personen hat ein Ausschluss gravierende Folgen, verunmöglicht er doch die Ausübung kernjuristischer Tätigkeiten, für die eine erfolgreiche zweite Prüfung Voraussetzung ist. Die Nichteinstellung zum Rechtsreferendariat unterliegt somit erhöhten Rechtfertigungsvoraussetzungen.
Insbesondere die AfD profitiert dabei von der begrifflichen Unsicherheit um die FDGO, welche die damalige „Berufsverbots“-Diskussion um staatliche Abwehrmaßnahmen in der 1970er Jahren begleitet haben und bis heute nicht restlos beseitigt sind. Gerade die sich andeutenden Erfolge bei der Neuauflage des Institutionenmarsches von rechts sollten aber zeigen, dass eine neue, klare Linie hinsichtlich extremistischer Bewerbungen im öffentlichen Dienst notwendig ist. Das Bundesverfassungsgericht hält sich bisher jedoch in diesem Feld zurück, sodass es bei der durchaus zweifelhaften Rechtsprechungslinie aus den 1970er-Jahren bleibt, deren Schwachpunkte populistischen Bewegungen argumentativ in die Hände spielen. Bund und Länder hatten 1972 im Wege des sog. Radikalenerlasses die Ablehnung oder Entfernung von vermeintlich verfassungsfeindlichen Personen vom bzw. aus dem öffentlichen Dienst verfügt. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte im Extremistenbeschluss (BVerfGE 39, 334) insbesondere die Ablehnung von Bewerber*innen, die einer als verfassungsfeindlich eingestuften Partei angehörten. Die Gelegenheit, sich anlässlich des Falles „Rechtsreferendar III. Weg“ inhaltlich mit dem Problemfeld auseinanderzusetzen, hat das Bundesverfassungsgericht verstreichen lassen. Auch das OVG hat sich nicht zu einer Vorlage nach Artwork. 100 GG veranlasst gesehen, hält eine Änderung der durchaus umstrittenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gleichwohl ausdrücklich für möglich (Rn. 15).
Die Anwendbarkeit beamtenrechtlicher Regelungen auf den juristischen Vorbereitungsdienst
Referendar*innen sind je nach Landesregelungen im Beamtenverhältnis auf Widerruf oder – wie die große Mehrheit – im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigt. Wird das Referendariat im Beamtenverhältnis absolviert, so findet jedenfalls die beamtenrechtliche Treuepflicht unmittelbare Anwendung. In einigen Bundesländern gelten – wie auch im aktuellen Fall des OVG Berlin-Brandenburg – die beamtenrechtlichen Vorschriften für Referendar*innen im Ausbildungsverhältnis kraft gesetzlicher Anordnung entsprechend. Hieraus wird teilweise eine entsprechend intensive Geltung der beamtenrechtlichen Treuepflicht für Rechtsreferendar*innen hergeleitet – so offenbar auch vom OVG.
Allerdings ist der Vorbereitungsdienst auch Voraussetzung für eine anwaltliche Tätigkeit, was das Rechtsreferendariat zu einem besonderen Ausbildungsverhältnis macht. Eine entsprechende Geltung der beamtenrechtlichen Treuepflicht wird dieser Besonderheit nicht gerecht und findet auch in der Verfassung keine Stütze. Selbst bei gesetzlicher Anordnung kann die beamtenrechtliche Treuepflicht jedenfalls nicht in der gleichen Intensität zur Anwendung gelangen. Vielmehr ist eine verfassungskonforme Auslegung geboten, welche die besonderen Umstände des staatlichen Ausbildungsmonopols für alle juristischen Berufe und die grundrechtlichen Implikationen berücksichtigt. Der schlichte Verweis auf die entsprechende Anwendbarkeit beamtenrechtlicher Treuepflichten greift daher jedenfalls zu kurz. Dies dürfte auch das OVG letztlich anerkennen, wenn es auf das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte „Leitbild für angehende Juristinnen und Juristen“ (Rn. 10 f.) abstellt, das sich aus der Verfassung selbst ergeben soll. Darin zeigt sich, dass tatsächlich dieses Leitbildbild für die Treuepflicht maßgeblich ist und nicht der Verweis auf das Beamtenrecht.
Die Auswirkungen von § 7 BRAO auf die Zulassungsvoraussetzungen
Die landesrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen zum Rechtsreferendariat limitieren mittelbar auch den Zugang zur Advokatur. Dies führt zu dem aktuellen Streit, ob und inwieweit die Länder bei der Ausgestaltung des Zugangs zum Rechtsreferendariat an die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) gebunden sind. Die freie Advokatur ist selbst ein lang erkämpftes Rechtsgut von fundamentaler objektiver Bedeutung (BVerfGE 63, 266 [282 f.]) und zeichnet sich gerade dadurch aus, dass die Berufsträger*innen nicht in gleichem Maße wie andere Jurist*innen den staatlichen Institutionen zu Treue verpflichtet sind. Dementsprechend ist die Zulassung zur Anwaltschaft nach § 7 S. 1 Nr. 6 BRAO nach aktueller Gesetzeslage lediglich dann zu versagen, wenn die antragstellende Individual die FDGO in strafbarer Weise bekämpft. Vor diesem Hintergrund kommt der VGH Sachsen zu dem Ergebnis, die Anforderungen an die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst dürften nicht höher sein als für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Dem hatte sich das VG Cottbus als Vorinstanz des OVG angeschlossen und explizit auf die fehlenden Vorstrafen des Bewerbers abgestellt. Auch die Justizministerkonferenz scheint der Ansicht des VGH Sachsen zuzuneigen, wenn sie nach ihrem Beschluss von Mai 2023 prüfen lassen will, ob eine Änderung von § 7 BRAO die Zulassung von Verfassungsfeinden zum Referendariat verhindern kann.
Dieser Lesart des VGH Sachsen, nach welcher die BRAO zum Maßstab für die Ausbildungsgesetze wird, ist das OVG nun entschieden entgegengetreten (Rn. 17). Das Gericht weist zunächst richtigerweise darauf hin, dass nach der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus den 1970er-Jahren (BVerfGE 46, 43) durchaus erhöhte Zulassungsvoraussetzungen für den juristischen Vorbereitungsdienst möglich sind (Rn. 11 ff.). Ob dies aber bereits aus einer mangelnden Vergleichbarkeit von Anwält*innen und Rechtsreferendar*innen vor dem Hintergrund von Artwork. 3 Abs. 1 GG folgt, wie das OVG wohl annimmt, ist fraglich. Richtigerweise sind die Juristenausbildungsgesetze nicht an der BRAO zu messen, sondern an dem Verfassungsgut der freien Advokatur selbst. Entscheidend ist nicht, ob eine JAG-Zugangsvoraussetzung über die BRAO hinausgeht, sondern, ob erstere als Beschränkung für den Anwaltsberuf noch zulässig wäre. Insbesondere § 7 BRAO ist daher nicht als Obergrenze für die Zulassungsvoraussetzungen des Vorbereitungsdienstes anzusehen.
Bedeutung der Rekonzeption der FDGO
Das OVG und auch die anderen mit dem Downside befassten Gerichte haben jedoch einen Umstand kaum berücksichtigt, der eine wichtige Rolle bei der rechtlichen Auseinandersetzung mit Bewerbungen extremistischer Personen spielt. Das Bundesverfassungsgericht hat in der NPD-Verbotsentscheidung von Januar 2017 die FDGO grundlegend neu konzipiert und positiv ausformuliert. Die Grundordnung umfasst seither lediglich noch die absolut elementaren Grundlagen menschenwürdigen und antiautoritärenZusammenlebens und wurde insofern gegenüber dem vorherigen, offeneren Begriffsverständnis erheblich reduziert (dies als „Verschlankung“ bezeichnend beispielsweise Wihl, KJ 56 (2023), S. 305 f) Die Tragweite dieser Rekonzeption ist bisher nur ansatzweise erkannt worden, obgleich sich die inhaltliche Präzisierung eines Rechtsguts grundsätzlich auf die Auslegung aller Vorschriften auswirken muss, die es schützen sollen. Mit der neuen Konzeption sind zwar alte Unklarheiten überwunden, aber durchaus auch neue Fragen aufgeworfen. So stellt die neue Konzeption mit der Menschenwürde einen politisch höchst aufgeladenen und umstrittenen Begriff in den Mittelpunkt.
Nimmt man die Reduktion der FDGO auf diese Kernelemente ernst, kann dies die Diskussion um extremistische Bewerbungen in mehrfacher Hinsicht voranbringen: Sie lässt sich zum einen dem Vorwurf einer politischen Selektion bei der Zulassung zum Rechtsreferendariat entgegenhalten, denn das Eintreten gegen die FDGO ist nach deutschem Demokratieverständnis gerade keine legitime politische Place, die es vor Diskriminierung zu schützen gilt. Staatskritische, auch radikale Positionen stehen (jedenfalls seit der Rekonzeption) nicht im Widerspruch zur FDGO, sodass sich für zahlreiche Bewerbungen ein Ausschlussgrund relativ klar verneinen lassen wird. Es geht „nur“ noch um die Kernelemente unverhandelbarer Verfassungsprinzipien, die dafür nun umso vehementer verteidigt werden können.
Zum anderen wirkt sich die klarere FDGO-Rechtsprechung auf die Auslegung und Fortbildung von Regelungen aus, die auf diese Grundordnung Bezug nehmen. Denn nach dem neuen Begriffsverständnis macht es bei Lichte besehen keinen relevanten Unterschied mehr, ob die Bekämpfung der FDGO „auf strafbare Weise“ oder auf anderem Wege geschieht. Zu unterscheiden ist allein noch, ob eine Individual aus Rechtsgründen aktiv zur Verteidigung der FDGO berufen ist (insbesondere im Beamtenrecht, etwa § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BeamtStG, § 66 Abs. 1 BBG) oder ob sie lediglich nicht darauf ausgehen darf, die Grundordnung zu beseitigen. Letzteres dürfte für den juristischen Vorbereitungsdienst gelten und darüber hinaus ein allgemeines verfassungsrechtliches Verbot sein. Das für die Bestimmung der Treuepflicht für Rechtsreferendar*innen maßgebliche „Leitbild eines angehenden Juristen“ wird durch die Rekonzeption der FDGO somit inhaltlich präzisiert. Für die Anwendung der Zulassungsvoraussetzungen durch die Oberlandesgerichte wird deutlicher, wann sich Tätigkeiten gegen die FDGO richten und die Bewerber*innen in der Folge für das Referendariat persönlich ungeeignet sind.
Zulassungsrecht ist auch Gefahrenabwehrrecht
Auch das klarere Bild von der FDGO hilft nicht über ein weiteres, bisher kaum geklärtes Downside hinweg: Welcher Grad an Gewissheit ist zu verlangen, wenn das OLG Bewerber*innen wegen verfassungsfeindlichen Bestrebungen ablehnen will? In diesem Punkt ist dem OVG nicht zuzustimmen, das nach verfassungskonformer Auslegung Zweifel an der Verfassungstreue nicht ausreichen lassen will, sondern eine erwiesene „Verfassungsfeindschaft“ fordert (Rn. 14). Richtigerweise kann es im Rahmen der Zulassungsentscheidung jedoch lediglich darum gehen, anhand des zurückliegenden Verhaltens der Individual ihr zukünftiges Verhalten zu prognostizieren. Der Einstellungsentscheidung liegen insofern gefahrenabwehrrechtliche Maßstäbe zugrunde, sodass letztlich kein Beweis, sondern nur eine tragfähige, grundrechtssensibel durchgeführte Prognose in Bezug auf zukünftiges verfassungsfeindliches Verhalten erforderlich ist. In diesem Punkt unterscheidet sich die Zulassung zum Rechtsreferendariat nicht von der Zulassung zu anderen staatlich reglementierten Berufsfeldern, sowie dem Gefahrenabwehrrecht allgemein, wo Prognoseentscheidungen üblich sind.
Dieser Blickwinkel der Prognose darf allerdings in keinem Fall dazu führen, dass über die herabgestuften Beweisanforderungen versteckte politische Filtermechanismen implementiert werden. Bei der gebotenen verfassungskonformen Auslegung sind daher hohe Anforderungen an die Tatsachen zu stellen, die als Foundation der Prognose eine „Verfassungsfeindlichkeit“ begründen sollen. Wie bei anderen Gefahrprognosen auch ist die Bedeutung des Schutzgutes entscheidend für die Frage, welcher Grad von Gefährdung zu fordern ist. So magazine die Einstellung in den Vorbereitungsdienst und die zweite Prüfung allein noch keine besonders machtvolle Place vermitteln, es wird aber jedenfalls der Zugang zu sensiblen Informationen eröffnet und regelmäßig auch eine außenwirksame Wahrnehmung hoheitlicher Tätigkeiten ermöglicht.
Der Blick ist außerdem auf Gefahren zu weiten, die abseits einer „Unterwanderung“ der Justiz gegeben sind. Wer den Rechtsstaat bekämpfen, Gerichte entmachten oder sogar eigene Herrschaftsstrukturen errichten will, benötigt rechtswissenschaftlichen Sachverstand. Die wirkmächtigsten Angriffe auf die freiheitliche Demokratie dürften weniger mit roher Gewalt als mehr im Wege missbräuchlicher Nutzung gewährter Rechte zu realisieren sein. Diese Rechte zu kennen und insbesondere den Unterschied zwischen (schein)legaler Ausnutzung und offensichtlichem Missbrauch ausmachen zu können, ist eine Fähigkeit, die von der Justiz nicht in falsche Hände gegeben werden darf.