Das Board of Peace (BoP), gegründet am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, inszeniert sich als pragmatischer Gegenentwurf zu den Vereinten Nationen, denen vorgeworfen wird, zu formalistisch und zu oft gescheitert zu sein. Sechzig Staaten wurden zur Mitarbeit eingeladen, einundzwanzig erklärten ihre Bereitschaft zum Beitritt. In Europa überwog jedoch die Skepsis. Die Absage Frankreichs beantwortete Trump mit der Androhung von Strafzöllen auf französische Wein- und Champagnerexporte – ein Vorgang, der das politische Klima illustriert, in dem das BoP operiert.
Als Friedrich Merz eine deutsche Beteiligung am von Donald Trump ausgerufenen Board of Peace aus „verfassungsrechtlichen Gründen“ ausschloss, konnte dies zunächst als politisch opportune „Ausrede“ gelesen werden. Der Verweis auf das Grundgesetz wirkte wie ein bequemer Ausweg aus dem seit Jahren heiklen Umgang mit dem US-Präsidenten: rechtlich formulierte Distanz anstelle offener politischer Ablehnung.
Der trumpsche Friedensaktionismus soll hier nicht weiter bewertet werden. Mir geht es vielmehr um die verfassungsrechtliche Dimension. Denn der Eindruck eines bloß vorgeschobenen Arguments täuscht: Bei näherem Hinsehen lassen sich durchaus verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine deutsche Beteiligung am BoP identifizieren.
Institutionelle Ambitionen außerhalb der Vereinten Nationen
Im November begrüßte der UN-Sicherheitsrat zunächst die Einrichtung eines BoP als Instrument zur Beendigung des Gaza-Konflikts und ermächtigte es, die zur Umsetzung des von Trump vorgelegten 20-Punkte-Plans erforderlichen Regelungen zu treffen. Die Unterstützung durch den Sicherheitsrat battle damit eindeutig auf diesen konkreten Konfliktkontext und auch zeitlich begrenzt.
Umso größer battle die Überraschung, als das BoP danach über diesen ursprünglichen Anwendungsbereich hinaus institutionalisiert wurde. Die Präambel seiner Charta formuliert dabei einen kaum versteckten Gegenentwurf zu den Vereinten Nationen, denen strukturelles Versagen vorgeworfen wird. Künftig soll das BoP Peacebuilding „in von Konflikten betroffenen oder bedrohten Regionen“ übernehmen (Artwork. 1 der Charta).
Während die US-Administration betont, das BoP werde „an der Seite“ der Vereinten Nationen agieren, lässt sich der institutionelle Anspruch kaum als bloße Ergänzung bestehender Strukturen verstehen. In diesem Sinne erscheint das BoP weniger als singuläre Initiative der Trump-Administration denn als weiteres Kapitel in der fortschreitenden Entfremdung der Vereinigten Staaten von den Vereinten Nationen (hier).
Völkerrechtlich handelt es sich beim BoP um eine internationale Organisation, die Völkerrechtspersönlichkeit gegenüber ihren Mitgliedsstaaten entfaltet. Staaten sind grundsätzlich frei, neue Formen institutionalisierter Zusammenarbeit zu schaffen, solange dadurch keine Verpflichtungen gegenüber Dritten verletzt werden. Auch ein programmatischer Gegenentwurf zu bestehenden Institutionen ist für sich genommen noch kein Völkerrechtsverstoß. Problematisch könnte es allerdings werden, wenn das BoP künftig Maßnahmen ergreift, die in den Anwendungsbereich bestehender Resolutionen des Sicherheitsrats fallen oder diesen widersprechen. Nach Artikel 103 der UN-Charta genießen im Konfliktfall Verpflichtungen aus der Charta Vorrang vor sonstigen völkerrechtlichen Abkommen.
Strukturelle Defizite
Für die rechtliche Bewertung des BoP ist weniger sein programmatischer Anspruch als vielmehr seine institutionelle Ausgestaltung entscheidend. Außerhalb des Gaza-Kontexts operiert das BoP mit drei zentralen Organen: dem Chairman, dem Board of Peace im engeren Sinne (Board) und dem Govt Board. Gerade diese Organisationsstruktur ist es, die schließlich verfassungsrechtliche Bedenken aufwirft.
Nach Artwork. 2(b) der Charta sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Operationen des BoP zu unterstützen und zu fördern, allerdings ausdrücklich nur im Rahmen ihrer jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung. Zugleich stellt die Charta klar, dass die Mitgliedstaaten dem BoP keine Hoheitsbefugnisse innerhalb ihres Staatsgebiets verleihen und sie ohne ihre Zustimmung nicht zur Teilnahme an bestimmten Peacebuilding-Missionen verpflichtet sind. Gleichwohl entfalten die Entscheidungen des BoP innerhalb dieses Rahmens völkerrechtliche Verbindlichkeit gegenüber seinen Mitgliedstaaten.
Gerade vor diesem Hintergrund erweisen sich die Governance-Strukturen der Organisation als problematisch. Entscheidungen werden zwar grundsätzlich vom Board getroffen, in dem jeder Mitgliedstaat über eine Stimme verfügt. Diese Entscheidungen stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Chairman, der nicht nur über ein Vetorecht verfügt, sondern zugleich die Agenda des Board bestimmt und bei Stimmengleichheit den Stichentscheid fällt. Das relativiert den Einfluss des Board als repräsentatives Organ der Mitgliedstaaten erheblich.
Chairman des BoP ist Donald Trump in seiner persönlichen Kapazität (Artwork. 3.2). Auch ein etwaiger Nachfolger wird nicht durch einen Wahlakt des Board bestimmt, sondern vom amtierenden Chairman selbst benannt. Eine Abberufung ist allein aus Gründen der Amtsunfähigkeit vorgesehen und setzt ein einstimmiges Votum des Govt Board voraus (Artwork. 3.3.). Weder haben die Mitgliedstaaten Einfluss auf die personelle Besetzung des Chairman-Amtes noch besteht ein effektiver Mechanismus politischer Verantwortlichkeit.
Hinzu tritt die herausgehobene Stellung des Chairman im institutionellen Gefüge. Ihm kommt die ausschließliche Befugnis zu, subsidiäre Organe einzurichten, zu verändern oder aufzulösen, etwa das Gaza Govt Board. Darüber hinaus ist er allein zur verbindlichen Auslegung der Charta befugt (Artwork. 7). Diese Konzentration zentraler Steuerungs- und Interpretationskompetenzen in einer einzelnen Privatperson ist für internationale Organisationen einmalig.
Besonders problematisch ist zudem das Verhältnis zwischen dem Board und dem Govt Board. Letzteres wird vollständig vom Chairman ernannt und soll sich aus „Führungspersönlichkeiten von internationalem Rang“ zusammensetzen (Artwork. 4.1(a)). Gegenwärtig bestehen sechs der insgesamt acht Mitglieder des Govt Board aus US-Staatsangehörigen. Das Govt Board ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, nämlich all solchen, die zur Erfüllung des Auftrags des BoP als „erforderlich und angemessen“ angesehen werden, und trifft seine Entscheidungen mit Mehrheit. Auch hier verfügt der Chairman über ein Vetorecht, zudem steht die Auslegung der Befugnisse des Govt Board in seinem Ermessen. Zwar berichtet das Govt Board formal an das Board, faktisch ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass es dessen Rolle in der Steuerung der Organisation überlagert oder gar verdrängt. Diese Struktur ist insbesondere deshalb bedenklich, weil das Govt Board weder demokratisch legitimiert noch in irgendeiner Type unmittelbar an die Mitgliedstaaten rückgebunden ist.
Sollte Deutschland dem BoP beitreten, könnte es daher völkerrechtlich verpflichtet sein, Operationen zu unterstützen, die maßgeblich vom Chairman und dem Govt Board geprägt werden. Auch wenn diese Verpflichtung ausdrücklich unter dem Vorbehalt des innerstaatlichen Rechts steht, wirft eine solche Bindung an Entscheidungen einer strukturell defizitären Organisation verfassungsrechtliche Bedenken auf.
Verfassungsrechtliche Bedenken
Verfassungsrechtlich entscheidend ist die Frage, unter welchen Bedingungen das Grundgesetz den Beitritt Deutschlands zu einer internationalen Organisation erlaubt. Das Grundgesetz enthält hierfür keine eigenständigen materiellen Voraussetzungen. Maßgeblich sind daher die allgemeinen Regelungen über die auswärtige Gewalt.
Nach Artwork. 59 Abs. 1 GG obliegt die völkerrechtliche Vertretung nach außen formal dem Bundespräsidenten, tatsächlich wird die auswärtige Gewalt jedoch von der Bundesregierung wahrgenommen. Ein deutscher Beitritt wäre allerdings nicht allein exekutiv zu vollziehen. Nach Artwork. 59 Abs. 2 GG bedürfen völkerrechtliche Verträge, die die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, der Zustimmung durch ein Bundesgesetz. Damit wird das Parlament an besonders bedeutsamen außenpolitischen Entscheidungen beteiligt.
Beide Alternativen wären vorliegend einschlägig. Zwar ist der Begriff des „hochpolitischen Vertrags“ restriktiv zu verstehen und nicht jeder Beitritt zu einer internationalen Organisation zustimmungsbedürftig. Gleichwohl sprechen gewichtige Gründe dafür, einen BoP-Beitritt in diese Kategorie einzuordnen. Hochpolitische Verträge sind solche, die die Stellung des Staates oder sein maßgebliches Gewicht in der Staatengemeinschaft berühren (BVerfGE 104, 151 (194) – Nato Konzept). Das BoP beansprucht, dauerhaft und konfliktübergreifend in internationale Friedensprozesse einzugreifen und sich damit in ein zentrales Feld deutscher Außen- und Sicherheitspolitik einzuschalten. Eine deutsche Mitgliedschaft würde additionally die außenpolitische Positionierung Deutschlands in einem institutionellen Rahmen beeinflussen und wäre „hochpolitisch“.
Darüber hinaus würde sich ein Beitritt auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen. Ein Zustimmungsgesetz ist erforderlich, wenn die geregelte Materie dem rechtsstaatlichen Vorbehalt des Gesetzes unterfällt. Durch die völkerrechtsverbindliche Unterstützungspflicht von Operationen des BoP könnte sich hierbei eine entsprechende Wesentlichkeit ableiten lassen (siehe für Sekundärrechtssetzung allgemein Frenzel 257, 258).
Grenzen der offenen Staatlichkeit
Eine Zustimmungspflicht könnte sich auch aus Artwork. 24 Abs. 1 GG i.V.m. Artwork. 59 Abs. 2 GG ergeben. Artwork. 24 Abs. 1 GG erlaubt es dem Bund, durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen, und ist Teil des Fundaments der offenen Staatlichkeit. Bei näherer Betrachtung ist diese Norm jedoch hier nicht einschlägig. Eine Übertragung von Hoheitsrechten setzt voraus, dass eine internationale Organisation befugt ist, mit innerstaatlich unmittelbarer Wirkung rechtsverbindlich zu handeln. Das BoP beansprucht eine solche supranationale Stellung gerade nicht.
Gleichwohl bleibt Artwork. 24 Abs. 1 GG related, weil er keine unbegrenzte Öffnung erlaubt. Eine absolute Schranke bildet das Grundgefüge der Verfassung, insbesondere die in Artwork. 79 Abs. 3 GG geschützten Strukturprinzipien des Artwork. 20 Abs. 1 und 2 GG. Was schon nicht durch Verfassungsänderung zulässig wäre, kann auch nicht auf eine zwischenstaatliche Einrichtung ausgelagert werden. In diesem Kontext hat das Bundesverfassungsgericht die Frage aufgeworfen, ob eine Übertragung zulässig wäre, wenn jeglicher Einfluss der Bundesrepublik auf die Entscheidungen der zwischenstaatlichen Einrichtungen ausgeschlossen wäre, oder sie gegenüber anderen vergleichbaren Staaten nur einen diskriminierten Standing einnähme (BVerfGE 68, 1 – Atomwaffenstationierung).
Demokratieprinzip als Grenze
Damit stellt sich die entscheidende Frage, wo die verfassungsrechtlichen Grenzen verlaufen, wenn – wie hier – keine Übertragung von Hoheitsrechten erfolgt. Niedrigere Anforderungen als das grundgesetzliche Strukturgefüge lassen sich kaum begründen. Das Zustimmungsgesetz ist ein „normales“ Bundesgesetz, das den Maßstäben des Grundgesetzes unterliegt und der Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht offensteht, auch wenn dieses bei der Bewertung außenpolitischer Entscheidungen einen weiten Einschätzungsspielraum zulässt. Vor diesem Hintergrund spricht vieles dafür, den Staatsstrukturprinzipien und den Grundrechten auch im Kontext von Völkerrechtsverpflichtungen, die den nationalen Gesetzgeber faktisch präjudizieren, Geltung zu verschaffen (so Frenzel 277, 278). Angesichts der ausgeprägten Organisationsdefizite des BoP rückt dabei insbesondere das Demokratieprinzip in den Mittelpunkt. Entscheidend ist, ob dieses Prinzip der Organisationsstruktur internationaler Organisationen Grenzen setzt, wenn deren Akte zwar nicht unmittelbar innerstaatlich gelten, aber politisch und völkerrechtlich auf Befolgung angelegt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Grundgesetz zugleich die Entscheidung für eine offene Staatlichkeit getroffen hat und internationale Integration ermöglichen will. Daraus folgt, dass nicht jede Abweichung von nationalstaatlichen Demokratieanforderungen verfassungsrechtlich problematisch ist.
So sind Mehrheitsentscheidungen selbst in supranationalen Organisationen grundsätzlich zulässig (BVerfGE 89, 155 – Maastricht). Ebenso sind unterschiedliche Stimmgewichtungen, sei es nach dem Prinzip „one state, one vote“ oder anhand von Proporzkriterien wie etwa staatlichen Quoten, ebenso akzeptiert wie die Übertragung bestimmter Entscheidungsbefugnisse auf verkleinerte Gremien, etwa den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Gemeinsames Merkmal dieser Strukturen ist jedoch, dass sie in eine Legitimationskette eingebunden bleiben: Die maßgeblichen Organe sind entweder selbst durch die Mitgliedstaaten zusammengesetzt oder zumindest mittelbar auf einen Wahl- oder Bestellungsakt aller Mitgliedstaaten zurückzuführen.
Gerade an dieser Stelle unterscheidet sich das BoP grundlegend von etablierten internationalen Organisationen. Die zentralen Organe, der Chairman und das Govt Board, sind vollständig aus der Legitimationskette herausgelöst. Der Chairman ist Donald Trump in persönlicher Eigenschaft; das Govt Board wird ausschließlich von ihm bestellt. Der einzige formale Auswahlmaßstab, die Zugehörigkeit zu „Führungspersönlichkeiten von internationalem Rang“, ist dabei weder objektiviert noch institutionell kontrolliert, sondern unterliegt allein der Auslegung des Chairman selbst.
Damit liegt ein wesentlicher Teil der Entscheidungsgewalt des BoP nicht bei den Mitgliedstaaten und ist auch nicht auf deren Legitimation zurückführbar. Die Mitgliedstaaten haben weder strukturellen Einfluss auf die personelle Zusammensetzung der entscheidenden Organe noch auf deren Willensbildung oder die Auslegung der Kompetenzen durch den Chairman. Der Einwand, eine Legitimationskette sei entbehrlich, weil viele Mitgliedstaaten internationaler Organisationen selbst nicht demokratisch verfasst seien, greift nicht durch. Maßgeblich sind nicht die innerstaatlichen Ordnungen anderer Staaten, sondern die verfassungsrechtlichen Anforderungen, die das Grundgesetz an die Beteiligung Deutschlands an internationaler Entscheidungsgewalt stellt. Die Entkoppelung wirft meines Erachtens zumindest verfassungsrechtliche Bedenken auf (ablehnend ggü. aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten Kriterien für Zusammensetzung und Beschlussfassung Frenzel, 283 ff.)
Bundeswehreinsatz im Rahmen des Board of Peace
Daneben stellt sich noch eine weitere, eher hypothetische Frage: Dürfte Deutschland – unter Berücksichtigung des wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalts – nach einem Beitritt zum BoP die Bundeswehr auf Grundlage eines BoP-Mandats für einen Peacebuilding-Einsatz zur Verfügung stellen? Dies hinge davon ab, ob das BoP als System kollektiver Sicherheit im Sinne des Artwork. 24 Abs. 2 GG qualifiziert werden könnte (BVerfGE 90, 286 – Out-of-area-Einsätze). Als solche Systeme gelten bislang die Vereinten Nationen, die NATO und die Europäische Union (Für NATO und UN siehe BVerfGE 90, 286 – Out-of-area-Einsätze; als für die EU vertretbar angesehen BVerfGE 152, 8 – Anti-IS-Einsatz).
Artwork. 24 Abs. 2 GG zielt auf die Einordnung Deutschlands in ein staatenübergreifendes System der Friedenssicherung ab. Ein solches System begründet für seine Mitglieder einen Standing wechselseitiger völkerrechtlicher Gebundenheit, der sowohl zur Wahrung des Friedens verpflichtet als auch Sicherheit gewährleistet. Unerheblich ist dabei, ob das System den Frieden primär unter seinen Mitgliedern sichert oder kollektiven Beistand gegen Angriffe von außen vorsieht.
Diese Voraussetzungen erfüllt das BoP nicht. Seine Charta enthält weder eine Beistandsklausel noch ein Verbot gewaltsamer Konflikte zwischen seinen Mitgliedern. Vielmehr handelt es sich um einen nach außen gerichteten Peacebuilding-Mechanismus, der in Konflikte eingreift, ohne seine Mitglieder selbst in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einzuordnen. Ein deutscher Beitritt würde daher nicht die Einbindung im Sinne des Artwork. 24 Abs. 2 GG darstellen, sondern die Beteiligung an einer punktuellen, nach außen gerichteten Friedensintervention. Einsätze der Bundeswehr auf Grundlage eines Mandats des BoP wären damit verfassungsrechtlich nicht tragfähig.
Mehr als abstrakte Zweifel
Das Argument, man müsse dem Board of Peace eine Probability geben, hat politischen Reiz. Doch die ausgeprägten institutionellen Defizite, die starke Konzentration von Entscheidungsbefugnissen und die nur unzureichende Rückbindung der Organe begründen mehr als bloß abstrakte Zweifel an der Vereinbarkeit eines Beitritts mit dem Grundgesetz.
Dass sich die Bundesregierung bislang zurückhaltend zeigt, ist daher nicht nur politisch nachvollziehbar – sondern verfassungsrechtlich intestine begründet.
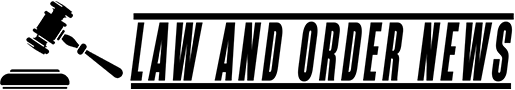
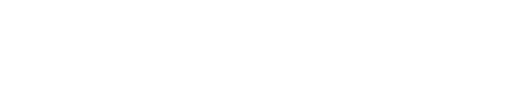







![Internship Opportunity at AGISS Research Institute [August 2024; Online; No Stipend]: Apply by August 9!](https://i2.wp.com/www.lawctopus.com/wp-content/uploads/2024/07/Internship-Opportunity-at-AGISS-Research-Institute-July-2024.jpg?w=120&resize=120,86&ssl=1)










